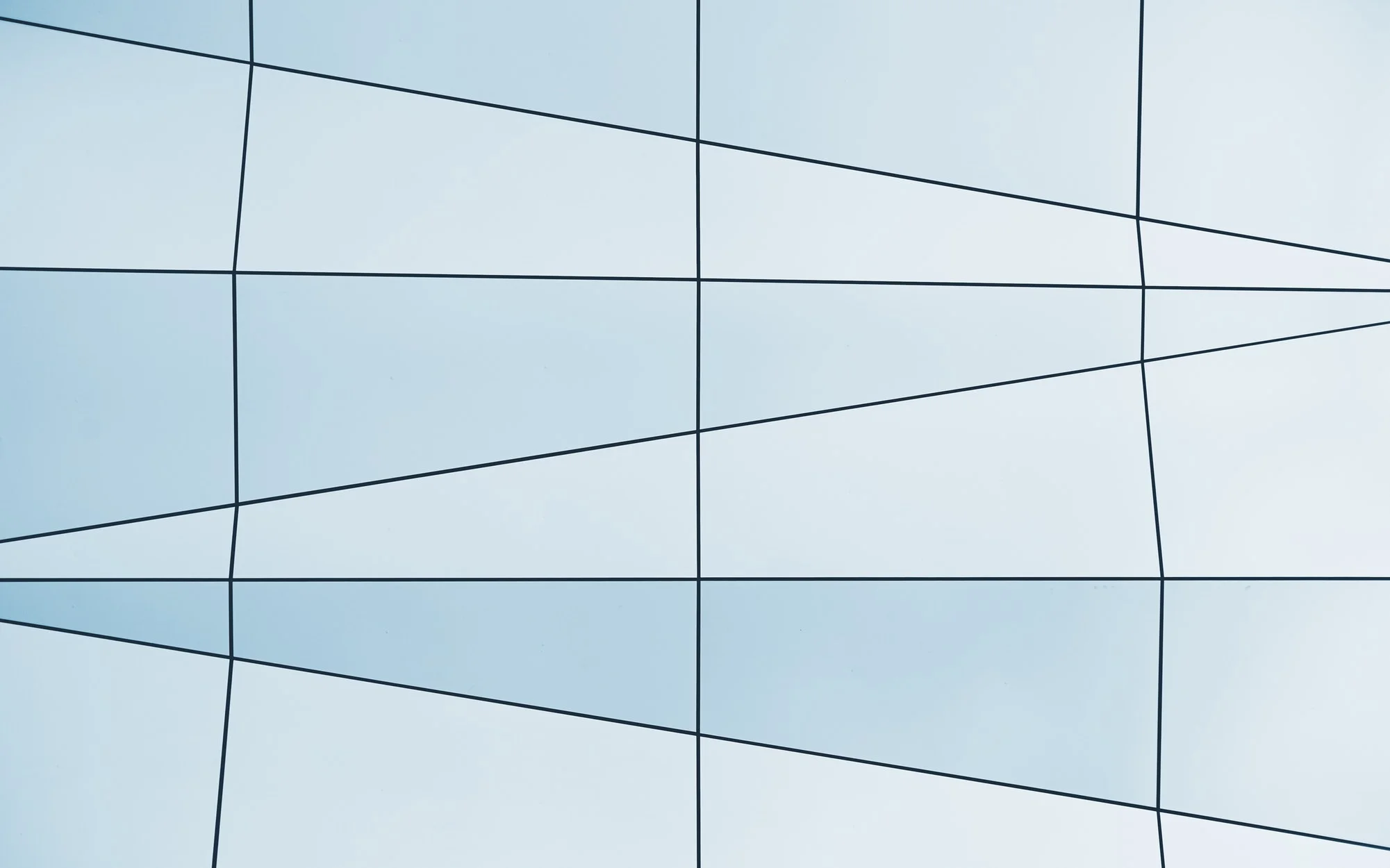Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) hat sich in seinem am 17.10.2017 verkündeten Urteil in der Rechtssache C-194/16 «Bolagsupplysningen vs. Svensk Handel» mit der Frage der gerichtlichen Zuständigkeit bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen von Unternehmen im Internet befasst.
Sachverhalt:
Die Klägerin, die Bolagsypplysningen OÜ, ist ein Unternehmen mit Sitz in Estland, die auch Handel in Schweden betrieb. Die Beklagte – Svensk Handel AB –, eine Gesellschaft in Schweden, in der verschiedene Arbeitgeber des Handelssektors zusammengeschlossen sind, betrieb eine Webseite auf der sich eine „schwarze“ Liste und ein Diskussionsforum befand. Auf dieser Webseite wurden unrichtige Angaben über das estnische Unternehmen veröffentlicht und dieses auf der „schwarzen“ Liste mit dem Vermerk eingetragen, die Bolagsypplysningen betreibe Betrug und Gaunerei. Im Diskussionsforum der Website fänden sich nahezu 1000 Kommentare, darunter direkte Aufrufe zur Gewalt gegen Bolagsupplysningen und ihre Mitarbeiter. Die Svensk Handel habe sich geweigert, den Eintrag und die Kommentare zu entfernen. Dadurch sei die wirtschaftliche Tätigkeit von Bolagsupplysningen in Schweden lahmgelegt, so dass ihr täglich materieller Schaden entstehe. Die Webseite von Svensk Handel war auch in Estland zugänglich, die streitigen Angaben und Kommentare seien jedoch in schwedischer Sprache verfasst und für den Grossteil der in Estland lebenden Personen nicht verständlich.
Das estnische Unternehmen nahm die Svensk Handel AB auf Richtigstellung der Angaben und auf Beseitigung der Kommentare auf der Webseite sowie auf Schadensersatz wegen entgangenem Umsatz in Anspruch und verklagte die Svensk Handel AB vor einem Gericht in Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Hiergegen wehrte sich Svensk Handel mit dem Einwand der gerichtlichen Unzuständigkeit estnischer Gerichte.
Streitig war die Auslegung von Artikel 7 Nr. 2 der Brüssel-I-Verordnung. Der estnische Oberste Gerichtshof ersuchte den EuGH daher um Präzisierung von Artikel 7 Nr. 2 Brüssel-I-Verordnung dahingehend, ob im Falle einer unerlaubten Handlung, die über das Internet begangen wurde (sog. Internetdelikt), eine gerichtliche Zuständigkeit nicht nur am Sitz des Verletzers/Schädigers, sondern auch an dem Ort begründet werden kann, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht.
„Mittelpunkt der Interessen“ massgeblich
Der EuGH stellte dazu fest (Hervorhebung durch den Verfasser):
„[…]dass eine juristische Person, deren Persönlichkeitsrechte durch die Veröffentlichung unrichtiger Angaben über sie im Internet und durch das Unterlassen der Entfernung sie betreffender Kommentare verletzt worden sein sollen, Klage auf Richtigstellung der Angaben, auf Verpflichtung zur Entfernung der Kommentare und auf Ersatz des gesamten entstandenen Schadens bei den Gerichten des Mitgliedstaats erheben kann, in dem sich der Mittelpunkt ihrer Interessen befindet.
Übt die betreffende juristische Person den größten Teil ihrer Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihres satzungsmäßigen Sitzes aus, kann sie den mutmaßlichen Urheber der Verletzung unter Anknüpfung an den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs in diesem anderen Mitgliedstaat verklagen.“
Der EuGH stellt bei der der Frage der gerichtlichen Zuständigkeit bei Internetdelikten auf den Mittelpunkt der Interessen des Unternehmens ab und führt damit seine in Bezug auf natürliche Personen entwickelte Rechtsprechung zu Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet (vgl. Urteil vom 25. Oktober 2011 «eDate Advertising», C-509/09 und C-161/10) fort und dehnt diese nun ausdrücklich auch auf juristische Personen aus.
Zur Konkretisierung des Mittelpunktes der Interessen des Unternehmens führen die Richter in Luxemburg aus (E. 41):
„Bei einer juristischen Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, wie der Klägerin des Ausgangsverfahrens, muss der Mittelpunkt der Interessen den Ort widerspiegeln, an dem ihr geschäftliches Ansehen am gefestigsten ist. Er ist daher anhand des Ortes zu bestimmen, an dem sie den wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausübt. Der Mittelpunkt der Interessen einer juristischen Person kann zwar mit dem Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes zusammenfallen, wenn sie in dem Mitgliedstaat, in dem sich dieser Sitz befindet, ihre gesamte oder den wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt und deshalb das Ansehen, über das sie dort verfügt, größer ist als in jedem anderen Mitgliedstaat, doch ist der Ort des Sitzes für sich genommen im Rahmen einer solchen Prüfung kein entscheidendes Kriterium.“
Im vorliegenden Fall lag der Mittelpunkt der Interessen des klägerischen Unternehmens im Sinne der Rechtsprechung des EuGH in Estland – die estnischen Gerichte waren damit zuständig für Klagen auf Berichtigung, Beseitigung und Schadensersatz.
Kein Kriterium bildete die Sprache und die Ausrichtung der Webseite – hier schwedische Sprache mit Ausrichtung auf Leser aus Schweden.
Was bedeutet dieses Urteil für die Schweiz?
Der EuGH hatte sich im vorliegenden Fall mit der Auslegung von Art. 7 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen – sogenannte ‚Brüssel-I-Verordnung‘ zu befassen. Diese Verordnung gilt für die Schweiz bekanntlich nicht. Allerdings ist die Schweiz Vertragsstaat des Lugano Übereinkommens (LugÜ), welches in Art. 5 Ziffer 3. des LugÜ eine identische Regelung gerichtlicher Zuständigkeiten für unerlaubte Handlungen vorsieht wie der vom EuGH im vorliegenden Fall auszulegende Art. 7 Nr. 2 Brüssel-I-Verordnung. Das LugÜ ist zwar vertragsautonom auszulegen, allerdings sieht es in Art. 1 Nr. 1 des Protokoll 2 des LugÜ vor, dass die Rechtsprechung des EuGH und der Gerichte der anderen Vertragsstaaten zum LugÜ und zur Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates und zu deren jeweiligen Vorgängererlassen gebührend zu berücksichtigen sind. Die Rechtsprechung des EuGH zu Parallelerlassen zum LugÜ wird denn auch vom Schweizerischen Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung (vgl. BGE 138 III 386 ff. E. 2.4) bei der Auslegung des LugÜ berücksichtigt, selbst wenn das Bundesgericht die Begründung des EuGH für wenig überzeugend erachtet (vgl. BGE 124 III 188 ff. E. 4b.).
Damit hat das vorliegende Urteil des EuGH unmittelbare Relevanz für Unternehmen in der Schweiz, die sich mit persönlichkeitsrechtsverletzenden bzw. unerlaubten Handlungen, die über das Internet begangen werden, konfrontiert sehen.
Daraus folgt, dass ein Schweizer Unternehmen, dessen Mittelpunkt seiner wirtschaftlichen Interessen in der Schweiz liegt, und das durch eine im Geltungsbereich des LugÜ liegenden Verletzer im Internet – etwa über eine Webseite, Internetportal, Bewertungsplattformen, social-media-Plattformen (facebook, xing & Co) oder Foren – in seinen geschäftlichen Ansehen beeinträchtigt wird, in der Schweiz klagen kann. Derartige unerlaubte Handlungen können sich aus schlechten Bewertungen, falschen Tatsachenbehauptungen oder rufschädigenden Äusserungen ergeben. Für die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen ist es im Übrigen unerheblich, ob lediglich Kommentare Dritter auf der Plattform widergegeben werden, der Plattformbetreiber also selber nicht der Urheber der verletzenden Äusserung ist. Weiter spielt es keine Rolle, ob die verletzenden Äusserungen in einer Schweizer Landessprache oder in einer anderen Sprache, z.B. Spanisch oder Englisch, abgefasst sind. Weiter spielt es auch keine Rolle, ob sich die Webseite erkennbar nur an ein Publikum des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Sprachregion richtet.