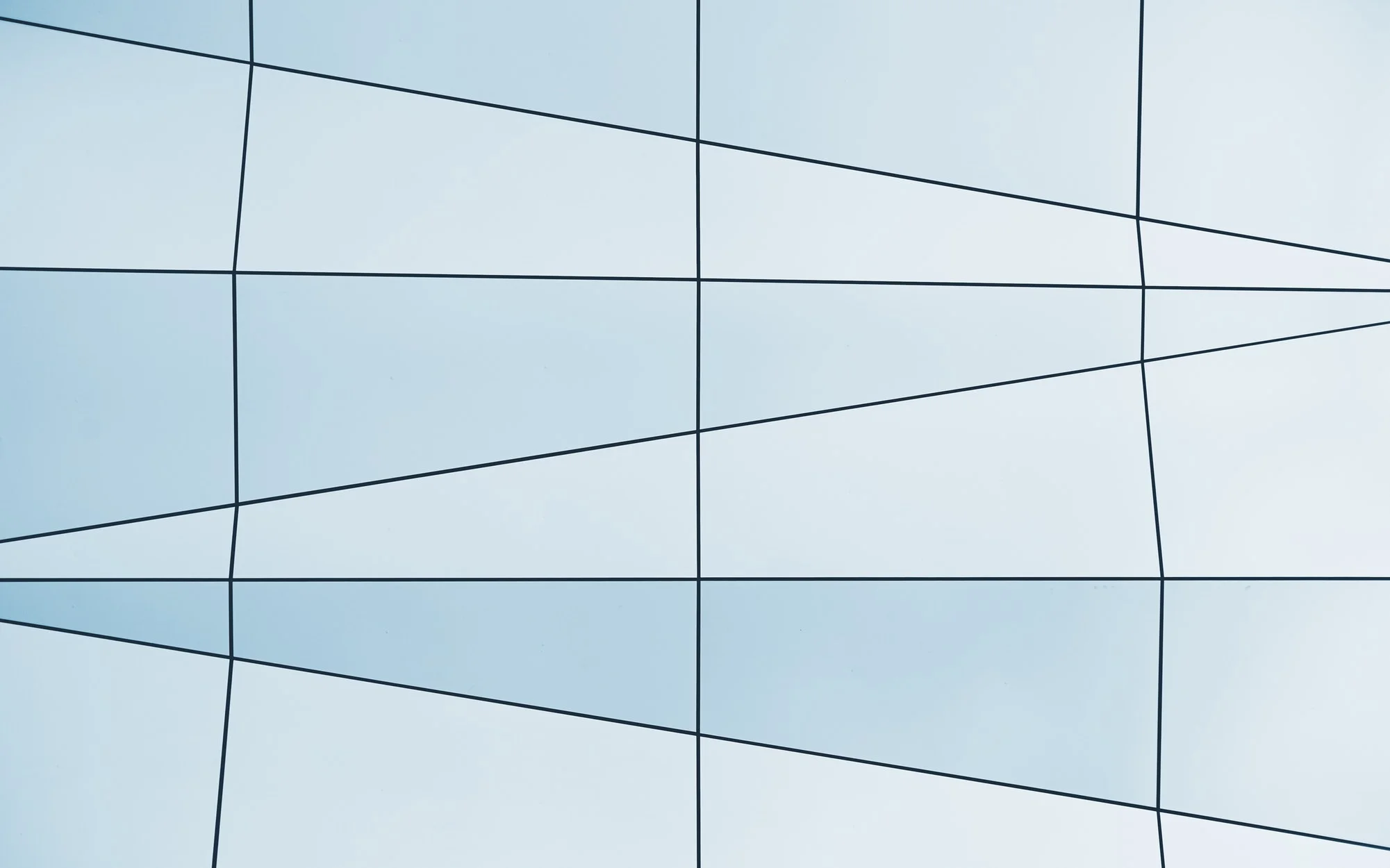Die GEMA hat im Streit mit der Videoplattform YouTube eine Niederlage erlitten. Das Landgericht Hamburg lehnte eine einstweilige Verfügung gegen YouTube ab. Die GEMA hatte beantragt, dass YouTube 75 Musikvideos löschen und auch den weiteren Abruf deutschlandweit sperren solle. YouTube muss die Musikvideos jetzt vorerst nicht löschen.
Das Landgericht Hamburg wies den Antrag der GEMA und anderer Verwertungsgesellschaften auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen YouTube mangels Eilbedürftigkeit zurück. Zur Begründung führte das Gericht aus, die GEMA und anderen Verwertungsgesellschaften hätten die Dringlichkeit einer vorläufigen Regelung nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Anders als in wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten werde bei einem urheberrechtlichen Anspruch eine solche Dringlichkeit nicht vermutet. Für die Richter habe sich nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit ergeben, dass die GEMA erst wenige Wochen vor dem Einreichen des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung von den konkreten Rechtsverletzungen erfahren habe. Dass Musikkompositionen im Dienst „YouTube“ genutzt werden, wäre den Antragstellerinnen lange bekannt. Auch das vorliegende einstweilige Verfügungsverfahren sei über einen Zeitraum von mehreren Monaten vorbereitet worden.
Hintergrund des Streits war, dass YouTube nach dem Auslaufen einer bis zum 31.03.2009 gültigen Nutzungsvereinbarung derzeit keine Lizenzen für die öffentliche Zugänglichmachung der Videos an die GEMA zahlt und diesbezügliche Verhandlungen bislang ergebnislos verliefen.
Die eigentliche Frage, nämlich ob die GEMA grundsätzlich von YouTube verlangen könne, es zu unterlassen, die fraglichen Videos mit den Musikstücken zu veröffentlichen, wurde vom Landgericht Hamburg jedoch nicht entschieden. Diese Frage müsste in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden, sofern es den Beteiligten nicht gelingt, sich außergerichtlich zu einigen.
Damit ist die einstweilige Verfügung für Youtube lediglich als ein Etappensieg zu werten. Auch soll der Gema-Anwalt, Medienberichten zufolge, bereits eine erneute Klage angekündigt haben.
Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigkeitsrechte) ist eine Verwertungsgesellschaft, die in Deutschland die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht von Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern von Musikwerken vertritt, die als Mitglieder in ihr organisiert sind. Das schweizer Pendant zur deutschen GEMA ist die SUISA (Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, frz. Suisse Auteurs).
Quelle: Pressemitteilung des Landgerichts Hamburg v. 27.08.2010
Das könnte Sie ebenfalls interessieren: